Nachhaltigkeit als Geschäftsprinzip
Den Themen nachhaltiges Wirtschaften und soziale Verantwortung stellen sich immer mehr Firmen.
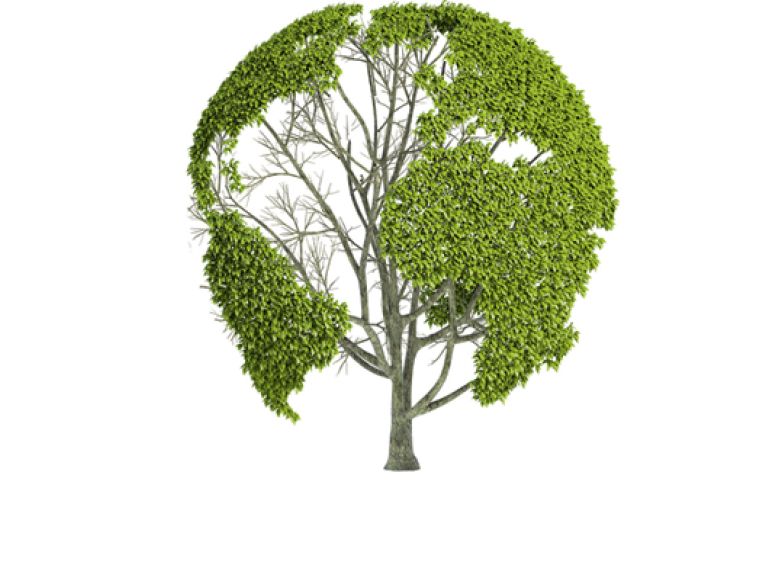
Die Käfer haben gut lachen, hier im US-Bundesstaat Tennessee: Rings um die Autofabrik am Volkswagen Drive in Chattanooga können sie sich ihres Lebens länger erfreuen als anderswo. Denn beim Bau des mit höchsten ökologischen Zertifikaten ausgezeichneten Werkes wurden die Straßen mit einem hellen Belag versehen. Der heizt sich nicht so stark auf und zieht nachts weniger Käfer und Insekten an – und entsprechend geringer ist die Zahl der am Morgen überfahrenen Tiere. Das klingt irgendwie niedlich – ist aber ein effektiver Beitrag von VW zum Naturschutz. Der Automobilhersteller ließ in einem mehrjährigen Programm für jeden seiner Standorte prüfen, welche Auswirkungen die Fabriken auf die Biodiversität der Umgebung haben und wie man sie verringern kann. In der „Green Factory“ in Chattanooga wird das praktiziert.
Seit 2009 setzt Volkswagen in dezidierten Umweltrichtlinien für alle Marken und Werke weltweit Standards. Der Wolfsburger Autobauer ist in Deutschland einer der Vorreiter, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften und Corporate Social Responsibility (CSR) geht. In den mehr als 90 Produktionsstätten weltweit hat er frühzeitig begonnen, die Themen in seiner Unternehmenskultur zu verankern. Bis 2015 sollen Investitionen von 50 Milliarden Euro in umweltfreundliche Modelle, Technologien und Werke fließen, als sichtbares Zeichen des Engagements.
Wie VW übernehmen inzwischen immer mehr deutsche Unternehmen im Ausland auf vergleichbare Weise gesellschaftliche Verantwortung. Mit Investitionen schaffen sie Arbeitsplätze und ermöglichen höhere Sozialstandards, verbessern Umweltschutz und Ausbildung ihrer Mitarbeiter. CSR kann einen wichtigen Beitrag zu einer fairen Gestaltung der Globalisierung leisten. Insbesondere seitdem infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise in der Öffentlichkeit verstärkt darüber diskutiert wird, welche sozialen und moralischen Anforderungen an Unternehmen gestellt werden müssen. Sich sozial und ökologisch zu engagieren sei für viele Unternehmen in Deutschland gelebte Praxis, schreibt die Bertelsmann-Stiftung in ihrer aktuellen Studie „CSR WeltWeit – Ein Branchenvergleich“. Die Stiftung hat darin untersucht, wie sich deutsche Unternehmen aus den sechs Branchen Automobil, Banken und Versicherungen, Chemie und Pharma, Elektro und Elektronik, Handel und Tourismus an ihren internationalen Standorten gesellschaftlich einbringen.
Das Fazit der Studie: Deutsche Konzerne erkennen immer häufiger, dass es sich lohnt, Aspekte der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in ihr Kerngeschäft zu integrieren, da dies im Ausland und in Deutschland Wettbewerbsvorteile bringe. Insgesamt seien die internationalen CSR-Aktivitäten deshalb positiv zu bewerten. Die branchenübergreifend wichtigsten Themen des Engagements – Umweltschutz, ökologisch und sozial verantwortungsvolle Wertschöpfungsketten, Förderung des gesellschaftlichen Umfelds und Mitarbeiterorientierung – zeigten, dass die Unternehmen die relevantesten Handlungsfelder auf der Agenda hätten. Allerdings sieht die Bertelsmann-Stiftung auch noch Raum für weitere Verbesserungen. Der Vorschlag daher: Unternehmen sollten im Rahmen ihrer internationalen CSR-Bemühungen künftig noch stärker auf Aktivitäten zur Gestaltung der Rahmenbedingungen ihrer Branche setzen. Noch sei diese Ebene des Engagements für viele Unternehmen keine Selbstverständlichkeit.
Hilfreich ist hier nach Auffassung von Experten auch die Unterstützung der Politik. Die Bundesregierung hat im Oktober 2010 die Nationale Strategie zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen in Form eines Aktionsplans CSR „Made in Germany“ verabschiedet. Wichtiges Anliegen des Aktionsplans ist es, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, der zu der Erkenntnis führt, dass CSR sich für Unternehmen und Gesellschaft gleichermaßen lohnt. Die Bundesregierung will Anreize zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung schaffen und Hilfestellungen zur Übersetzung des CSR-Ansatzes in den Unternehmensalltag bieten. Auf diesem Weg sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ermuntert werden, ihr gesellschaftliches Engagement strategisch im Kerngeschäft zu integrieren. Während bei vielen Großkonzernen CSR-Strategien schon weitgehend verankert sind und weiter an Bedeutung gewinnen werden, haben viele kleinere und mittlere Unternehmen noch Nachholbedarf.
Wie auch der Mittelstand aktiv Verantwortung tragen kann, zeigt das Beispiel der Firma Deerberg. Der in Niedersachsen ansässige Versandhandel für naturbelassene Textilien beschäftigt 400 Mitarbeiter und praktiziert seit Langem effektive Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Deerberg steht damit positiv da in einer Branche, in der Unternehmen häufiger für schlechte Arbeitsbedingungen bei den Lieferanten oder den zu hohen Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid kritisiert werden. Deerberg verwendet ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen. Sämtliche Lieferungen – im Saisongeschäft bis zu 10 000 täglich – werden klimaneutral verschickt. Die hübsch gestalteten Versandkartonagen können von den Kunden später als Aufbewahrungskartons oder als Regalelemente genutzt werden. Kommen sie bei Retoursendungen wieder ins Haus, werden sie möglichst wiederverwendet. Resultat: Das Abfallaufkommen bei Deerberg ist deutlich kleiner geworden.
Auch Deerberg verfügt, ähnlich wie VW, über feste Unternehmensgrundsätze und erwartet von seinen Zulieferern die Einhaltung dieser Werte und Richtlinien. Das fällt leichter, weil nur mit einer kleinen Anzahl europäischer Hersteller langjährige Beziehungen gepflegt werden; trotzdem nimmt der Einkauf regelmäßig vor Ort Inspektionen vor. Da man keine eigenen Materialtests durchführen kann, orientiert sich das Unternehmen gern an Zertifizierungen oder seriösen Produktstandards.
Keine Frage: Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend – sie wird zu einer unternehmerischen Grundhaltung und bestimmt das Handeln einer wachsenden Zahl deutscher Firmen. Sozioökologische Aspekte gewinnen aber noch in einem weiteren Bereich an Bedeutung: Immer mehr Städte und Kommunen richten sich nach Kriterien der Nachhaltigkeit aus. So begutachteten die Juroren des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2012 immerhin 119 Einreichungen von Kommunen. Tübingen etwa hat Nachhaltigkeit in die Grundsätze des Verwaltungshandelns aufgenommen und sich ambitionierte Ziele zur Verringerung des CO2-Ausstoßes gesetzt. Neumarkt in der Oberpfalz beteiligt die Bürger an ihrem Stadtleitbildprozess und ist erste Fairtrade-Stadt Bayerns. Bereits dreimal wurde das Städtchen im Rahmen der Dekade zur Bildung für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgezeichnet. Und das schwäbische Ludwigsburg führt seit 2004 einen umfassenden Stadtentwicklungsprozess mit festen strategischen Zielen durch, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen.
Diese und andere Beispiele stimmen optimistisch: Neben Regierungen und NROs übernehmen immer mehr Firmen und Kommunen aktiv Verantwortung für Mensch und Natur und eine lebenswerte Zukunft – gute Beispiele, die Schule machen sollten. ▪
Kay Dohnke