Wie wird das Gehirn mit Stress fertig?
Deutsche und israelische Neurobiologen wollen am neuen Max Planck – Weizmann Laboratory in Rehovot Antworten auf eine Kernfrage unserer Zeit finden.
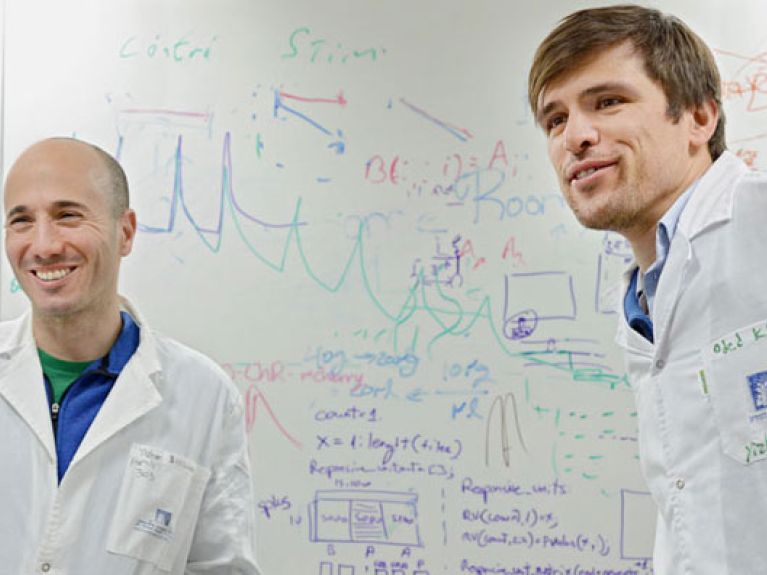
Jede Menge weißer Kittel hängen überall an den Türen in der Abteilung für Neuropsychiatrie und neurogenetische Verhaltensforschung im Weizmann-Institut. Kaum jemand hier aber trägt so einen. Das mag beitragen zu der informellen Atmosphäre, die von den Deutschen gerne als „typisch israelisch“ beschrieben wird. Das renommierte Forschungsinstitut in Rehovot bildet da keine Ausnahme. Seit März 2014 arbeiten n dem „Max Planck – Weizmann Laboratory for Experimental Neuropsychiatry and Behavioral Neurogenetics“ israelische und deutsche Wissenschaftler zusammen. Sie beschäftigen sich mit einem Kernproblem der heutigen Zeit: den Ursachen von kognitiven, emotionalen und neurologischen Krankheiten.
Der Leiter, Professor Alon Chen, kann den Forschungsgegenstand auch einfach beschreiben: Man will wissen, wie das Gehirn mit Stress fertig wird. Die Antworten seien sehr komplex, da nicht einheitlich. Von zehn Soldaten, die etwa im Krieg alle das gleich Trauma erlebt hätten, indem sie ihre Freunde neben sich sterben sahen, entwickelten nur 15 Prozent eine Posttraumatische Posttraumatische Belastungsstörung. Heute sei noch ungeklärt, warum manche an solchen Erlebnissen zerbrechen, andere sie aber unbeschadet überstehen. „Wir wollen herausfinden, wie sich das Stress-System, das sich in so einer Situation anschaltet, wieder ausschalten lässt. Wenn das gelingt, dann ist der Weg frei für die Behandlung von Depressionen und Ängsten. Wir sind schon auf halber Strecke angelangt, aber vieles kann bisher eben nur teilweise angewandt werden.“
Auch Alon Chen sitzt ohne Kittel am Schreibtisch in seinem kleinen Büro. An der Wand hängt ein gerahmtes Poster in deutscher Sprache: „Der Mensch als Industriepalast“ – die Abbildung vergleicht die organischen Funktionen des Körpers mit industriellen Vorgängen. Chen ist eigentlich Experte für Mäusegenetik, aber sein Aufgabenfeld ist fast ausschließlich das eines Managers – in doppelter Funktion. Seine beiden Visitenkarten weisen ihn aus als Professor für Neurobiologie am Weizmann-Institut und als Direktor des Departments für Stress, Neurobiologie und Neurogenetik am Max-Planck-Institut in München. In diesen Funktionen leitet er auch das israelisch-deutsche Labor. Rund 30 Wissenschaftler sind dort insgesamt beschäftigt; die Projekte laufen zum Teil in Israel, zum Teil in Deutschland. Da die Zusammenarbeit keine transatlantischen Flüge bedeutet, betont Chen, könne man gegenseitig viel von diesem regen Austausch profitieren.
Über den Zugewinn sind sich beide Seiten weitgehend einig: Für die Israelis stellt das Max-Planck-Institut mit seiner angegliederten Klinik einen wichtigen Partner dar, weil auf diese Weise mit mehr Mitteln und vor allem auch Zugriffen auf „human samples“ geforscht werden kann. Umgekehrt profitieren die Deutschen von einem Forschungsansatz, der sich durch weitaus weniger Bürokratie und mehr Risikofreudigkeit auszeichnet. Es sind fast schon Klischees, aber sie kehren in den Gesprächen immer wieder: Demnach ergänzten sich deutsche Solidität samt langfristiger Planung sehr gut mit den hierarchiefreieren und flexibleren Strukturen in Israel. In Deutschland werde sehr gut dokumentiert und präserviert, sagt Chen, in seinem jungen Land hingegen habe man dafür weniger Geduld und Zeit.
Ethische Standards in Deutschland und Israel seien ähnlich, anders aber die Geschwindigkeiten, mit denen die erforderlichen Genehmigungen erteilt würde. „Was in Deutschland sechs Monate braucht, dauert in Israel vielleicht drei Wochen. Wir sind da unkomplizierter, weniger bürokratisch“. Dafür seien die Deutschen höchst zuverlässlich, was Termine angehe. „Wenn sie mir sagen, dass am 2. Februar um 14 Uhr die neue Cafeteria fertig sein wird, dann gibt es um diese Uhrzeit dort auch den ersten Kaffee.“ Fest eingefahrene Strukturen hat Alon Chen versucht, in München aufzubrechen. Dass man ihn dort heute mit seinem Vornamen anredet, wie in Israel üblich, statt mir Herr Professor, gehört ebenso dazu wie die Einrichtung der besagten Cafeteria, „Jetzt gibt es dort einen Ort, wo man sich ganz informell einfach austauschen kann, die Leute kannten einander ja oft nicht einmal mit Namen.“
Chen ist 44 Jahre alt und als Sohn marrokanischer Einwanderer in der israelischen Wüstenstadt Beer Shewa aufgewachsen. Er war Fallschirmspringer in der Armee, hat auch eine Zeitlang in den USA studiert. Die deutsche Vergangenheit spiele in seinem Alltag keine Rolle, sagt er, auch wenn sie sich nicht einfach zur Seite schieben lasse. Er will sich dafür einsetzen, dass ein Buch über die facettenreiche Geschichte des Max-Planck-Instituts, das es bisher nur auf Deutsch gibt, auch in einer englischen Ausgabe erscheint.
In einem kleinen Raum unweit von Chens Büro forscht gerade Matthias Prigge, 34, aus dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Mithilfe eines Mikroskops misst er Gehirnschnitte von Mäusen. Zuvor hat man ein weibliches Versuchstier mit Mäusebabies zusammengebracht, um die es sich mütterlich kümmerte. Jetzt geht es darum, herauszufinden, wie sich dieses Verhalten auf die Verschaltung des Gehirns auswirkt. Prigge ist seit zweieinhalb Jahren Post-Doktorand in Rehovot. Promoviert hat er an der Humboldt-Universität Berlin, seinen jetzigen Chef Ofer Izhar, 39, hat er in Stanford kennengelernt. Dessen früherer Vorgesetzter wiederum war selbst Post-Doktorand im Max-Planck-Institut gewesen. Izhar sagt, dass er mit dieser Art von Kooperation quasi aufgewachsen sei. Sie komme ihm ganz natürlich vor.
Es ist diese Entwicklung über die Jahre, die der Präsident des Weizmann-Instituts, Professor Daniel Zajfman, als „von unten gewachsen“ bezeichnet. Bereits im Jahr 1959 hatte sein Institut eine deutsche Delegation der Max-Planck-Gesellschaft nach Israel eingeladen. Dieser Austausch hat später zur Gründung der Minerva-Stiftung geführt, Prigge ist einer ihrer Stipendiaten. Er war auch in Rehovot, als es im Sommer 2014 Raketen auf Israel hagelte. Niemals hätte er zuvor gedacht, dass er hier forschen würde und zwischendurch immer wieder in den 200 Meter entfernten Bunker laufen würde.
Auch der deutsche Forscher verweist auf die flachen Hierarchien und den unkomplizierten Umgang bei den Israelis. In den Seminaren trauten sich die Studierenden in Israel eher nachzufragen, wenn ihnen etwas unklar sei. „Ich weiß, dass es eigentlich keine dummen Fragen gibt, aber viele trauen sich das dann doch oft nicht so unbefangen in Deutschland“. Auch Ideen ließen sich in einer freieren Atmosphäre so leichter entwickeln. Beste Voraussetzungen also für gute Forschungsergebnisse.